
„Dranbleiben!“
Chronische Schmerzen besser verstehen und behandeln: Ein Gespräch mit Prof. Dr. Heike Rittner, Pionierin der Schmerzmedizin, über Motivation, Erfahrungen als Frau in der Wissenschaft und Möglichkeiten zukünftiger Schmerzmedizin.
„Ich rate jungen Frauen, sich Mentorinnen und Mentoren zu suchen, die sie unterstützen und ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Entscheidend ist ein starkes Netzwerk, aber auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.“
Prof. Heike Rittner, Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Schmerzmedizin (ZiS) und des Lehrstuhls Schmerzmedizin an der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. Mit Beginn dieses Semesters Prodekanin der Medizinischen Fakultät.
„Ich rate jungen Frauen, sich Mentorinnen und Mentoren zu suchen, die sie unterstützen und ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Entscheidend ist ein starkes Netzwerk, aber auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.“
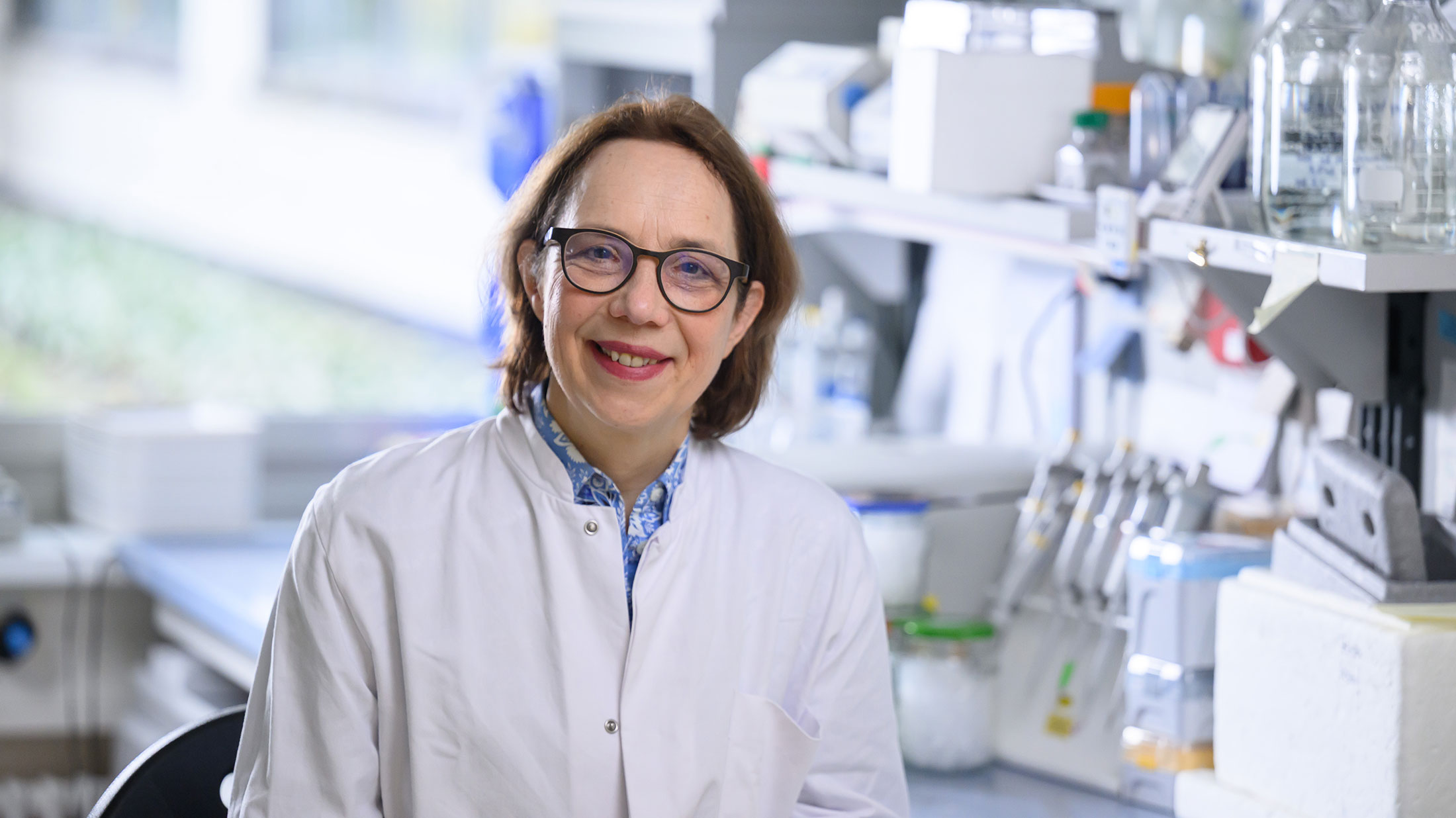
Prof. Heike Rittner, Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Schmerzmedizin (ZiS) und des Lehrstuhls Schmerzmedizin an der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. Mit Beginn dieses Semesters Prodekanin der Medizinischen Fakultät.
Gab es einen bestimmten Moment oder eine Person, die Sie inspiriert hat, den Weg in die Wissenschaft einzuschlagen?
Ja. Mein Onkel, ein Rechtsmediziner und Immunforscher, hat mich sehr unterstützt und inspiriert. Vor allem während meiner Schulzeit und zu Beginn des Medizinstudiums hatte ich viele Gespräche mit ihm, die mir halfen, mich für Medizin zu entscheiden. Wir sprachen viel über wissenschaftliche Themen. Das weckte meinen Wunsch, selbst in der Forschung tätig zu werden. Auch meine Tante, die Biologin war, hatte einen großen Einfluss auf mich – indem sie mir zeigte, wie spannende Wissenschaft in der Praxis aussieht.
Welche Hürden haben Sie als Frau in der Wissenschaft erlebt?
Forschung erfordert viel Durchhaltevermögen. Immer gibt es Momente des Zweifelns. Zum Beispiel dann, wenn man Ablehnungen von Anträgen oder Publikationen erfährt. Genau weiß man ja nicht, woran es liegt. Doch ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, den wissenschaftlichen Weg zu verlassen. Was mir geholfen hat, dranzubleiben, war vor allem die Überzeugung oder auch die Eigenmotivation, dass es ein waste of talent* wäre, meine Chancen nicht zu nutzen. Außerdem hat mir mein Mann immer den Rücken gestärkt. Das war entscheidend, um Familie und Karriere miteinander vereinbaren zu können.
Welche Eigenschaften braucht eine junge Frau, um sich in der Wissenschaft durchzusetzen?
Ich rate jungen Frauen, sich Mentorinnen und Mentoren zu suchen, die sie unterstützen und ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Entscheidend ist ein starkes Netzwerk, aber auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Wichtig ist außerdem, sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen und sich bewusst zu machen: In manchen Lebensphasen kann man weniger leisten – und in anderen dann wieder durchstarten. Was in meiner Arbeitsgruppe und in der Schmerzklinik besonders gut funktioniert, ist die Unterstützung füreinander. Wir haben viele Frauen im Team, die sich gegenseitig motivieren und inspirieren.
Welche Mentoren oder Mentorinnen in der Wissenschaft waren für Sie besonders prägend?
An der Mayo Clinic in den USA, als ich in der Rheumatologie tätig war, hatte ich das Professorenehepaar Cornelia Weyand und Jörg Goronzy als Chefs. Beide zeigten mir, wie man Forschung erfolgreich mit dem persönlichen Leben vereinbaren kann. Später war Prof. Christoph Stein an der Charité in Berlin einer derjenigen, die mich wissenschaftlich und menschlich geprägt haben. Besonders dankbar bin ich in Würzburg für die kontinuierliche wissenschafltiche Förderung und den Freiraum durch die beiden Klinikdirektoren der Anästhesiologie, Prof. Norbert Roewer und Prof. Patrick Meybohm.
Jetzt sind Sie selbst Mentorin. Was machen Sie anders?
Ich merke zunehmend, dass es individuelle Wege gibt, die ich als Mentorin unterstützen möchte. Es ist nicht mehr möglich, alle „über einen Kamm zu scheren“. Einfach, weil jede und jeder eine andere Lebenssituation hat. Oft erhalte ich als Frau mehr Einblicke in persönliche Herausforderungen meiner Mentees. Mir ist wichtig zu verstehen, wo sich jemand insgesamt befindet, um dann gemeinsam zu überlegen, wie der nächste Schritt aussehen kann. Ich erinnere mich, dass ich damals selbst als Mentee nie mit meinem Mentor über ein Thema wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen hätte. Das wäre einfach nicht üblich gewesen. Aber heute sehe ich es als hilfreich an, meinen Mentees auch praktische Tipps zur Organisation von Familie und Arbeit zu geben, wenn sie das wünschen. Das macht die Unterstützung viel konkreter und greifbarer.
Welche Veränderungen wünschen Sie sich für Frauen in der Wissenschaft in den nächsten zehn Jahren?
Ich wünsche mir, dass die Hierarchien in der Medizin flacher werden und mehr eigenverantwortliche Zwischenstufen entstehen. Das ist zeitgemäß und würde Frauen und Männern zugutekommen, weil es individuelle Karrierewege ermöglicht und die Bedeutung der Forschung für die Klinik deutlicher und nachvollziehbarer macht. Forschung ist ungemein kreativ und bietet viel Sinn. Weil es darum geht, das Leben vieler Menschen nachhaltig zu verbessern. Wenn mehr Ärztinnen und Ärzte diesen Mehrwert erkennen, wird der Aufwand für Forschung verständlicher und auch motivierender.
Wie sieht Ihre persönliche Vision für die Schmerzmedizin der Zukunft aus? Welche Rolle spielen Frauen darin?
Ich möchte die molekularen Mechanismen besser verstehen, um noch gezielter und individueller helfen zu können. Schmerz ist eine eigenständige Krankheit. Frauen spielen meiner Meinung nach eine wichtige Rolle, weil sie intelligent, kreativ, systemisch denkend und einfühlsam sind. Zugleich muss die Schmerzmedizin interdisziplinärer werden, um alle Aspekte der Erkrankung – biologisch, psychologisch und sozial – zu berücksichtigen.
Wenn Sie die Chance hätten, eine einzige Sache im Wissenschaftssystem sofort zu ändern, was wäre das?
Die immer stärker zunehmenden bürokratischen Anforderungen, zum Beispiel bei Ethik- oder Drittmittelanträgen, verlangsamen kreative wissenschaftliche Prozesse und nehmen immer mehr Zeit meines Tages in Anspruch. Rückbesinnung auf das Essenzielle würde sehr helfen. So entstünden zugleich Räume für neue Ideen und Eigenverantwortung – was die Forschung fördert und dabei die Vereinbarkeit von Familie und Karriere erleichtert.
Welche Ratschläge würden Sie jungen Forscherinnen geben, die sich fragen, ob sie Karriere und Familie miteinander vereinbaren können?
Wichtig ist, sich von Anfang an ein starkes Netzwerk aufzubauen, um den Spagat zwischen Familie und Karriere zu meistern. Der Austausch mit anderen, die ähnliche Themen und Erfahrungen haben, ist enorm wertvoll. Und: in schwierigen Phasen dranbleiben! Auch ich war zu manchen Zeiten meines Lebens mehr für die Kinder verantwortlich, während mein Mann in seiner Karriere weiterkam. Aber wir haben uns immer gegenseitig unterstützt.
Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft der Forschung im Bereich Schmerzmedizin und darüber hinaus?
Ich wünsche mir, dass wir in der Schmerzmedizin eine noch individuellere, personalisierte Behandlung entwickeln können, die auf den molekularen Mechanismen der Patienten basiert. Aber das ist nur ein Teil der Antwort. Schmerzmedizin muss immer auch ein interdisziplinärer Ansatz bleiben, der Psychologie, Physiotherapie und andere Disziplinen integriert. Außerdem wünsche ich mir mehr Mut bei jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unkonventionelle Wege zu gehen und neue Ansätze zu verfolgen, auch wenn der Weg steinig ist. Nur so können wir echte Fortschritte erzielen. * waste of talent (engl.) meint Verschwendung von Talent